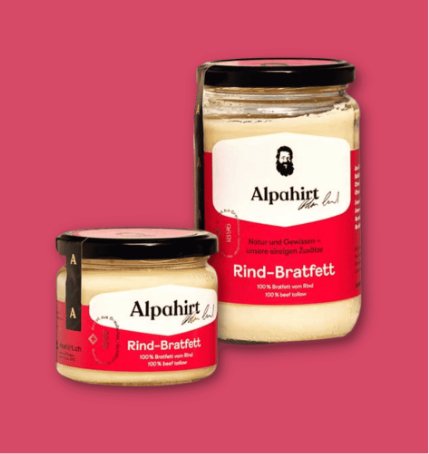Manchmal wirkt die Schweiz wie ein Land voller Widersprüche. Da produzieren wir hochwertiges Fleisch in Rekordmengen und importieren gleichzeitig mehr denn je.
Im ersten Halbjahr 2025 ist das inländische Fleischangebot erneut gestiegen, insbesondere bei Rind und Geflügel. Und trotzdem: Auch die Importzahlen schnellen in die Höhe.
Wie passt das zusammen? Und was sagt das über unser Konsumverhalten und unsere Vorstellung von „regional“ wirklich aus?
Key Takeaways: Was du wissen musst
- Im ersten Halbjahr 2025 wurden in der Schweiz 3,8 % mehr Fleisch produziert, vorwiegend Rind und Geflügel.
- Trotzdem stieg der Fleischimport um 15,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf über 102’000 Tonnen.
- Der Inlandanteil sinkt über alle Fleischarten hinweg.
- Besonders deutlich ist der Rückgang bei Schweine- und Geflügelfleisch, wo Importe deutlich zulegen.
- Das zeigt: „Regional“ verliert an Bedeutung, sobald der Preis entscheidet. Und Billigfleisch bleibt gefragt.
Wie viel Fleisch produziert die Schweiz und wie viel importieren wir?
Die Schweiz produziert mehr Fleisch – und importiert gleichzeitig mehr denn je. Ein scheinbarer Widerspruch, der sich bei näherem Hinsehen als systemisches Problem entpuppt.
Laut dem aktuellen Bericht von Proviande ist das Rindfleischangebot im ersten Halbjahr 2025 um 1,4 % gestiegen. Gleichzeitig wuchsen die Importe von Rindfleisch um 13,3 %. Anders gesagt: Trotz wachsender Inlandproduktion steigt der Bedarf an ausländischem Fleisch weiter. Und dieser Trend zeigt sich nicht nur beim Rind.
Rindfleisch: Inlandanteil unter Druck
Mit einer Inlandproduktion von rund 40'360 Tonnen im ersten Halbjahr 2025 bleibt Rind zwar ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Fleischwirtschaft. Doch der Anstieg bei den Importen sorgt dafür, dass der Inlandanteil weiter sinkt. Dass inländisches Fleisch immer häufiger mit importierter Ware konkurrieren muss, ist besonders problematisch, da es unter strengeren Tierwohl- und Umweltstandards produziert wird – und damit teurer ist.

Schweine- und Geflügelfleisch: Rückzug und Substitution
Schweinefleisch zeigt einen anderen Trend: Die Inlandproduktion ging hier weiter zurück (–3,4 % bei Schlachtungen), ein bewusster Entscheid vieler Produzent:innen, um kostendeckend zu arbeiten. Die Lücke wird durch Importe gedeckt.
Beim Geflügelfleisch wächst die Inlandproduktion zwar (+3,7 %), doch gleichzeitig bleibt der Importanteil mit über einem Drittel hoch. Besonders auffällig: Ein grosser Teil dieser Importe stammt aus Ländern mit deutlich niedrigeren Standards, etwa Brasilien.
Mehr Angebot und trotzdem Importdruck
Obwohl also in allen Bereichen mehr oder gleich viel Fleisch zur Verfügung steht, nimmt der Importdruck weiter zu. Ein Zeichen dafür, dass nicht die Verfügbarkeit, sondern der Preis und die Marktlogik entscheidend sind, auch wenn das auf Kosten von Tierwohl, Transparenz und regionaler Wertschöpfung geht.
Der Preis ist heiss: Was unser Konsumverhalten über uns verrät
Warum importiert ein Land Fleisch, obwohl es selbst genügend produziert? Die Antwort liegt selten in der Notwendigkeit und fast immer im Preis.
Ein Blick in die Abverkaufszahlen im Detailhandel zeigt: Fleisch bleibt beliebt, aber gleichzeitig steigt auch der Preisdruck. Zwar ist der Absatz 2024 gestiegen, und zwar um knapp 4 % gegenüber dem Vorjahr. Doch im ersten Halbjahr 2025 sank die Verkaufsmenge wieder leicht um 1,4 %. Die Gründe sind vielfältig: Höhere Preise für Inlandfleisch, stagnierende Kaufkraft und ein anhaltender Trend zu Sonderangeboten.
Preis schlägt Prinzip
Konsument:innen geben sich gerne nachhaltig, doch am Regal entscheidet meistens leider der Preis. Das zeigt sich besonders bei importiertem Geflügel, das deutlich günstiger angeboten werden kann als inländische Ware. Auch beim Rind lässt sich mit tiefgefrorenen Importstücken aus Übersee viel sparen. Dabei bleibt meist unklar, unter welchen Bedingungen das Fleisch produziert wurde.
Billig verdrängt besser
Dieser Preiswettbewerb hat Folgen: Inländische Produzenten geraten unter Druck, obwohl sie nach strengeren Richtlinien arbeiten. Wer höhere Tierwohl- und Umweltstandards einhält, kann mit Billigimporten kaum mithalten, es sei denn, die Konsument:innen sind bereit, mehr zu zahlen für weniger, aber besseres Fleisch.
Zwischen Ideal und Realität
Der Widerspruch ist offensichtlich: Einerseits gibt es den Wunsch nach Regionalität, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Auf der anderen Seite schlägt die Realität im Einkaufswagen erbarmungslos zu. Diese Diskrepanz offenbart ein Kernproblem unserer Fleischversorgung: Das Verhalten an der Kasse widerspricht vielfach dem moralischen Anspruch.
Regional: Ein Begriff verliert an Bedeutung
„Regional“ klingt gut, verkauft sich gut und wird aber auch immer öfter missbraucht. Wer heute Fleisch mit dem Label „aus der Region“ kauft, geht davon aus, dass das Tier in der Nähe aufgewachsen, geschlachtet und verarbeitet wurde. Doch die Realität sieht oft anders aus.
Region ist, was der Detailhandel daraus macht
Viele Detailhändler nutzen den Begriff „regional“ sehr weit gefasst. So kann ein Produkt, das in der Schweiz verarbeitet wurde, schon als „regional“ gelten, auch wenn das Fleisch selbst aus dem Ausland stammt. Oder „regional“ wird auf eine ganze Grossregion bezogen, die sich über mehrere Kantone oder sogar Länder erstreckt. Das Resultat: Ein Begriff ohne verlässliche Bedeutung, der Vertrauen verspielt.
Label-Flut statt Klarheit
Zahlreiche Labels versprechen Nachhaltigkeit, Tierwohl und Regionalität. Doch kaum ein Konsument durchblickt das Label-Wirrwarr vollständig. Während einige Programme wie „Suisse Garantie“ oder „IP-Suisse“ tatsächlich für Schweizer Herkunft stehen, werden gleichzeitig Importprodukte mit regionalen Assoziationen vermarktet, etwa durch Landschaftsbilder oder Begriffe wie „Alpenküche“ oder „Bergkräuter“.
Wenn alles regional ist, ist nichts mehr regional
Diese Verwässerung trifft auch ehrliche Produzenten. Wer wirklich regional und nachhaltig arbeitet, gerät unter Erklärungsdruck. Wenn die Herkunft nicht klar erkennbar ist, zählt am Ende wieder nur der Preis. Und das untergräbt jene, die sich für Transparenz und Qualität einsetzen.
Was es jetzt braucht und was wir selbst tun können
Die Zahlen sind klar: Die Schweiz produziert mehr Fleisch, aber noch mehr wird importiert. Das schadet der Glaubwürdigkeit von Regionalität, untergräbt faire Produktionsbedingungen und bringt selbst bewusste Konsument:innen in eine schwierige Lage. Was braucht es, damit sich das ändert?
1. Mehr Transparenz im Handel
Wer Fleisch verkauft, muss klar sagen, woher es kommt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Keine schwammigen Begriffe, keine Alpenpanoramen auf südamerikanischen Pouletstreifen. Sondern klare Herkunftsangaben, nachvollziehbare Produktionswege und ein Ende der Irreführung.
2. Politischer Rückhalt für Inlandproduzenten
Wer nach hohen Standards produziert, verdient politische Unterstützung: durch gezielte Fördermassnahmen, bessere Kennzeichnungspflichten und die Verteidigung fairer Marktbedingungen. Wenn der Markt „regional“ will, dann muss die Politik dafür sorgen, dass echt regional auch konkurrenzfähig bleibt.
3. Aufwertung des Konsums – nicht der Menge
Ein Grossteil des Problems liegt im Überangebot und in der Masse. Doch Fleisch ist kein Massenprodukt. Es sollte etwas Besonderes bleiben, also ein bewusst gewähltes Lebensmittel mit Geschichte, Herkunft und Verantwortung. Das bedeutet auch: Weniger Fleisch, aber dafür besseres Fleisch.
4. Verantwortung beginnt im Einkaufswagen
Am Ende liegt es an uns allen. Jeder Einkauf ist eine Entscheidung für oder gegen Regionalität, für oder gegen faire Tierhaltung, für oder gegen Transparenz. Wer weniger, aber besser konsumiert, unterstützt nicht nur uns ehrliche Produzenten, sondern auch eine enkeltaugliche Zukunft.
Fazit: Weniger, aber dafür besser
Die Schweiz produziert gutes Fleisch. Regional, kontrolliert, mit hohen Standards. Und trotzdem wächst der Markt für Importe, weil der Preis stimmt, weil „regional“ nicht mehr klar ist, und weil wir oft schneller handeln als denken.
Doch genau da liegt die Chance: Wer sich für weniger, aber hochwertigeres Fleisch entscheidet, kann aktiv zur Lösung beitragen. Nicht jeder muss zum Bio-Puristen werden. Aber jeder Entscheid für echtes Schweizer Fleisch ist ein Schritt in Richtung nachhaltiger Landwirtschaft, fairer Marktbedingungen und mehr Transparenz.
Produzenten wie Alpahirt zeigen, dass es auch anders geht: mit klaren Werten, ehrlicher Herkunft und kompromissloser Qualität. Wir leben das, was viele sich viele wünschen und was unsere Landwirtschaft langfristig auch braucht.
Häufige Fragen zum Schweizer Fleischmarkt
Warum importiert die Schweiz Fleisch, obwohl sie selbst genug produziert?
Die Schweiz importiert Fleisch, obwohl sie die Inlandproduktion erhöht hat, weil der Konsumbedarf durch Inlandware allein nicht gedeckt werden kann, insbesondere bei günstigen Produkten wie Geflügel oder verarbeitetem Fleisch. Preis und Verfügbarkeit spielen eine grosse Rolle. Zudem ist importiertes Fleisch meist deutlich günstiger, was die Nachfrage im Detailhandel ankurbelt.
Was bedeutet „regional“ beim Fleischkauf wirklich?
„Regional“ beim Fleischkauf ist kein geschützter Begriff und wird leider im Detailhandel oft sehr weit ausgelegt. Ein Produkt kann „regional“ beworben werden, obwohl das Fleisch aus dem Ausland stammt, solange es in der Schweiz verarbeitet wurde. Wer echte Regionalität will, muss auf klare Herkunftsangaben und vertrauenswürdige Labels achten.
Wie kann ich beim Fleischkauf nachhaltig handeln?
Nachhaltig handeln heisst: Weniger Fleisch, dafür bewusster konsumieren. Achte auf Herkunft, Produktionsweise, Tierhaltung und Transportwege. Kaufe direkt beim Produzenten oder bei Anbietern, die auf Transparenz und Qualität setzen, etwa bei Alpahirt, wo du weisst, was drin ist und wo’s herkommt.
Welchen Einfluss hat mein Konsumverhalten auf den Fleischmarkt?
Dein Konsumverhalten bestimmt mit, welche Art von Fleisch nachgefragt wird und damit auch, wie produziert wird. Wer Billigware kauft, stärkt das System der Importe. Wer hochwertiges, lokal produziertes Fleisch wählt, unterstützt eine nachhaltige Landwirtschaft und faire Bedingungen für Tier und Mensch.
Ist weniger Fleisch wirklich besser für die Umwelt?
Ja. Weniger Fleisch zu essen reduziert den ökologischen Fussabdruck deutlich, vor allem, wenn auf importiertes Billigfleisch verzichtet wird. Die Umwelt profitiert hingegen, wenn Tiere artgerecht gehalten, lokal geschlachtet und vollständig verwertet werden. Das Prinzip „weniger, aber besser“ gilt hier doppelt.
Quellen
- Proviande (2025): Der Fleischmarkt im Überblick 2024, https://www.proviande.ch/sites/proviande/files/2020-05/Der Fleischmarkt im Überblick - Aktuelle Ausgabe.pdf, abgerufen 28.10.2025
- Der Schweizer Bauer (2025): 16 Prozent mehr Fleisch importiert, https://www.schweizerbauer.ch/markt-preise/marktmeldungen/16-prozent-mehr-fleisch-importiert, abgerufen 28.10.2025
- Agrarbericht 2024: Fleisch und Eier, https://www.agrarbericht.ch/de/markt/tierische-produkte/fleisch-und-eier#:~:text=Aussenhandel,sowie Wurstwaren und Rohschinken importiert, abgerufen 28.10.2025