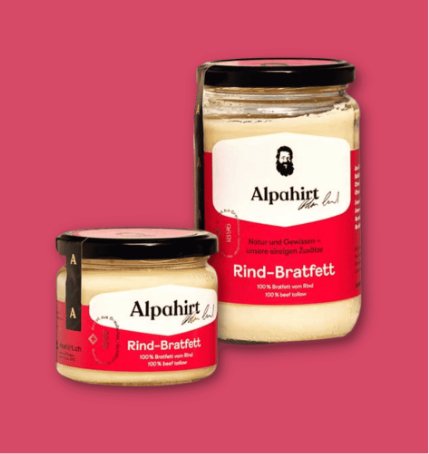Am 11. November, dem Martinstag, duftet es vielerorts nach Gans. In Wirtshäusern und Küchen brutzelt, was seit Jahrhunderten als Symbol für Grosszügigkeit gilt. Die Geschichte erinnert an den Heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Ein Zeichen der Nächstenliebe und Bescheidenheit.
Doch während die Gans einst Ausdruck des Dankes war, ist sie heute oft nur noch Teil eines jährlichen Rituals. Über 90 % der Gänse, die zu St. Martin auf Schweizer Tellern landen, stammen aus industrieller Mast, meist aus Polen oder Ungarn. Lange Transporte, Stopfmast, Antibiotikaeinsatz – davon war bei Martin keine Rede. Teilen wir da wirklich oder konsumieren wir bloss noch?
Das Wichtigste im Überblick
- Rund 90 % der Gänse, die in der Schweiz zu St. Martin serviert werden, stammen aus industrieller Massenhaltung, meist importiert.
- Der ursprüngliche Gedanke des Martinstags war Teilen, Dankbarkeit und Bescheidenheit und nicht Überfluss.
- Alpahirt zeigt, dass man Traditionen bewahren kann, ohne sie aber zu kopieren und zwar mit regionalem Naturfleisch, ehrlicher Herkunft und Respekt vor dem Tier.
- Bewusster Genuss bedeutet nicht Verzicht, sondern Sinn: kleiner im Umfang, grösser im Wert.
Von der Legende zum Konsumritual
Die Geschichte des Heiligen Martin von Tours ist eine der ältesten und bekanntesten Erzählungen des Teilens in Europa. Martin war römischer Soldat, als er eines Wintertages einem frierenden Bettler begegnete. Ohne zu zögern schnitt er seinen Mantel entzwei und gab die Hälfte dem Mann. In der folgenden Nacht erschien ihm Christus im Traum, bekleidet mit eben diesem halben Mantel, und Martin erkannte, dass Mitgefühl mehr zählt als Macht.
Der Martinstag, der am 11. November gefeiert wird, war über Jahrhunderte ein fester Bestandteil des bäuerlichen Jahreslaufs. Es war die Zeit, in der Pachtverträge endeten, Vorräte geteilt und das Vieh für den Winter vorbereitet wurde. Aus dieser Tradition heraus wurde auch geschlachtet. Man teilte das Fleisch mit Nachbarn, Bediensteten oder Armen – ein Akt der Gerechtigkeit und Gemeinschaft.
Heute hat sich dieses Ritual weit von seiner ursprünglichen Bedeutung entfernt. In vielen Haushalten steht die Martinsgans als selbstverständlich festliches Gericht auf dem Tisch, oft, ohne zu wissen, woher das Tier stammt oder wie es gelebt hat.
Rund 90 Prozent der Gänse in der Schweiz werden importiert, meist aus Ungarn oder Polen, wo Massentierhaltung und Stopfmast noch immer weitverbreitet sind.
Die Tiere werden in engen Ställen gemästet, teils mit Zwangsfütterung, um eine möglichst grosse Leber zu erzielen. Vor ihrem Tod legen sie oft Hunderte Kilometer Transportstrecke zurück. Dies ist natürlich ein stiller Widerspruch zum Gedanken des Teilens und der Dankbarkeit.
Wer heute also zum traditionellen Gänsebraten am Martinstag greift, folgt nicht mehr einem Brauch, sondern vielmehr einer Gewohnheit ohne zu wissen, warum man es eigentlich tut. Der Martinstag, einst Symbol für Empathie und Gemeinschaft, droht zum reinen Konsumfest zu werden, mit übervollen Tellern, aber leeren Werten.
Doch genau hier liegt die Chance. Traditionen sollen keinesfalls abgeschafft werden, wenn wir sie nur einfach neu verstehen. Sie dürfen sich wandeln, so wie sich unsere Gesellschaft wandelt. Statt blinden Nachahmens zu St. Martin können wir fragen: Was wollte dieser Tag ursprünglich ausdrücken und wie können wir das heute leben?
Teilen ja – stopfen nein
Teilen war nie eine Frage des Überflusses, sondern eine Frage des Herzens. Im ursprünglichen Sinn des Martinstags ging es nicht darum, sich satt zu essen, sondern darum, Dankbarkeit zu zeigen und Gemeinschaft zu leben. Heute aber steht oft das Gegenteil auf dem Tisch: Tiere, die gestopft wurden, damit wir mehr haben, als wir brauchen.
Wir finden: Teilen darf wieder das bedeuten, was es einmal war, nämlich Achtsamkeit statt Ausschweifung, Verbindung statt Verschwendung. Wenn wir zusammenkommen, um gutes Essen zu teilen, dann soll es etwas sein, das mit Respekt entstanden ist.
Bei Alpahirt steht dieser Gedanke im Mittelpunkt. Unsere Tiere wachsen draussen auf, fressen Gras und Alpenkräuter und leben im Rhythmus der Natur. Das ist unsere Art zu teilen: mit dem Tier, mit der Natur, mit den Menschen, die unser Fleisch geniessen.
Denn Teilen heisst nicht, grosse Portionen zu servieren. Teilen heisst, das Beste zu geben und zwar mit Bewusstsein und Wertschätzung.
Wenn wir den Martinstag so verstehen, wie er einst gemeint war, bekommt er seinen Sinn zurück. Dann ist der Duft aus der Küche nicht das Symbol des Überflusses, sondern der Erinnerung daran, dass Genuss und Verantwortung wunderbar zusammenpassen.
Kleine Rituale mit grossem Wert
Traditionen leben davon, dass wir sie weitergeben, und nicht, dass wir sie kopieren.
Der Martinstag bietet die schöne Gelegenheit, alte Werte in neuer Form zu pflegen.
Nicht mit Braten und Prunk, sondern mit kleinen, ehrlichen Gesten, die Gemeinschaft spürbar machen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Martinsplättli?
Ein Teller mit regionalen Spezialitäten von Alpahirt – Salsiz, Bergfleisch, vielleicht dazu noch etwas Alpkäse und ein Stück frisches Brot vom lokalen Bäcker. Er ist schnell vorbereitet, braucht keine Showküche und steht für das, was St. Martin wollte: teilen, was man hat. Ein solches Plättli auf den Tisch zu stellen, mit Freunden oder Familie, ist mehr als ein Essen ist ein echter und purer Moment der Verbundenheit.
Oder du bäckst mit den Kindern ein Martinsbrot. In Graubünden war es früher Brauch, am Martinstag ein rundes Brot zu teilen, oft mit Nachbarn, manchmal mit jenen, die weniger hatten. Heute kann dieses Ritual ganz einfach wiederbelebt werden: ein duftendes Brot, gebacken aus regionalem Mehl, das man mit einem lieben Menschen teilt.
Wer mag, kann den Tag auch nutzen, um bewusst zu verschenken: ein Paket Alpahirt-Produkte als kleines Dankeschön, ein Stück Genuss als Zeichen der Wertschätzung.
Denn Teilen heisst nicht nur, etwas abzugeben … es heisst, jemandem zu zeigen: Ich denke an dich.
In Graubünden gehörte dieses Denken lange zum Alltag. Man half einander, tauschte Vorräte, brachte den Älteren ein Stück Fleisch oder Käse. Es war selbstverständlich, dass man nur dann gut über den Winter kam, wenn man zusammenhielt. Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft des Martinstags und sie passt heute besser denn je: Gemeinsamkeit statt Konsum.
Fazit von Adrian
Wenn ich an den Martinstag denke, denke ich weniger an Tradition als an Bedeutung.
An die Idee, etwas zu teilen, das man selbst auch schätzt. Ich erinnere mich an meine Kindheit in Graubünden: Da wurde kein grosses Festessen inszeniert, aber man kam zusammen. Es gab einfache Gerichte, ehrliche Gespräche und ein wunderbares Gefühl von Nähe.
Heute sehe ich, wie viele alte Bräuche zu Gewohnheiten geworden sind. Manchmal bleibt nur noch die Form und nicht mehr der Sinn. Aber das Schöne ist: Wir können das ändern,
Indem wir uns wieder fragen, warum wir etwas feiern, nicht nur wie.
Für mich ist der Martinstag kein Tag des Überflusses, sondern der Erinnerung. Er erinnert daran, dass Teilen nicht bedeutet, weniger zu haben, sondern, dass etwas Wertvolles erst entsteht, wenn man es miteinander teilt.
Darum feiern wir bei Alpahirt den Martinstag auf unsere Art: ohne Martinsgans, aber dafür mit ehrlichem Fleisch aus Graubünden, mit Produkten, die ihren Ursprung kennen, und mit dem Wunsch, dass Genuss wieder etwas Echtes ist.
Traditionen verändern sich – und das ist auch gut so.
Denn wenn sie ihren Sinn behalten, bleiben sie lebendig.
Quellen
- Euromeat: 98 percent of imported goose meat in 2021 came from Poland and Hungary, https://euromeatnews.com/Article-Germany:-98-percent-of-imported-goose-meat-in-2021-came-from-Poland-and-Hungary/5867